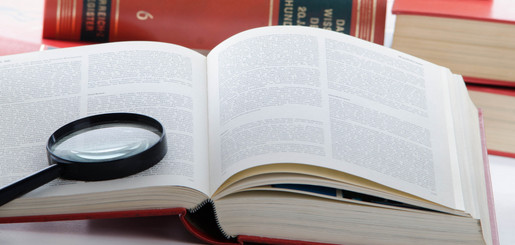5. Seniorenpolitische Fachtagung des dbb
Wohnen im Alter
Die Wohnungsmarktsituation in Deutschland ist angespannt. Hohe Preise in den Ballungsräumen und schwindende Infrastrukturen auf dem Land machen besonders Seniorinnen und Senioren zu schaffen. Die politischen Versäumnisse der vergangenen Jahre im sozialen Wohnungsbau und bei der Daseinsvorsorge haben gravierend Auswirkungen auf die Wohnsituation einer alternden Gesell-schaft. Fachleute aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Gewerkschaften beleuchteten die ver-schiedenen Aspekte des Themas am 21. Oktober 2019 im dbb forum berlin.
Als „tickende Zeitbombe“ hat der Zweite Vorsitzende des dbb Friedhelm Schäfer die Entwicklung des Wohnungsmarktes in Deutschland bezeichnet und gefordert, wohnungsmarkt- und infrastrukturpolitische Instrumente ganzheitlich einzusetzen, um zukunftsorientierte Lösungen zu entwickeln.
Die Wohnungsmisere sei nicht über Nacht entstanden, sondern ein Ergebnis jahrzehntelanger Fehlplanung und Fehlinvestition: „Ballungsräume haben nicht ausreichend bezahlbaren Wohnraum, ländliche Räume keine ausreichende Infrastruktur. Hinzu kommen die Folgen des demografischen Wandels wenn junge Menschen in die Stadt ziehen, während Ältere bei schwindender Infrastruktur auf dem Land zurückbleiben“, so Schäfer. Die Politik habe diese Entwicklung zwar erkannt, es mangele aber an konkreten Gegenmaßnahmen.
Bei der Verbesserung ländlicher Infrastrukturen vorwiegend auf Digitalisierung zu vertrauen, sei zu kurz gedacht: „Ältere und gesundheitlich beeinträchtigte Menschen können nicht ohne Weiteres Computer und Internet nutzen, weil die technischen Hürden für viele zu hoch sind. Außerdem sind zwischenmenschliche Kontakte und der persönliche Austausch unerlässlich“, sagte der dbb Vize. Das müsse sich im infrastrukturellen Angebot von der Mobilität bis zur medizinischen Versorgung widerspiegeln. „Die Erreichbarkeit von Behörden, Apotheken, Medizin und Pflege ebenso wie Bildungs- und Kulturangeboten ist dabei eine besondere Herausforderung. Wir werden uns von lieb gewonnenen Gewohnheiten verabschieden müssen. Aber die Menschen können auch erwarten, dass sie für die Belange des täglichen Lebens nicht erst 30 Kilometer fahren müssen.“ Ebenso müssten alternative und finanzierbare Wohnformen für Senioren intensiver gefördert werden - auf dem Land und in der Stadt.
Klitzing: Generationengerecht wohnen
Der Vorsitzende der dbb bundesseniorenvertretung Horst Günther Klitzing attestierte Bund, Ländern und Gemeinden wohnungsmarktpolitische Konzeptlosigkeit: „Ein behördliches Zuständigkeitswirrwarr fördert Insellösungen und verhindert schnelle Veränderungen. Die Politik hat kaum Perspektiven für individuelle Lebensplanungen der Menschen, und in vielen Entscheidungsgremien scheint Ideologie wichtiger zu sein als weitsichtige und nachhaltige Lösungen.“ Als Konsequenz aus dem 7. Altersbericht der Bundesregierung von 2017 forderte Klitzing die Schaffung von mehr generationengerechtem Wohnraum durch Neu- und Umbau, die Entwicklung alternativer Wohnformen sowie die Förderung technischer Assistenzsysteme. „Die Empfehlungen der Altersberichte müssen mehr Beachtung in der politischen Praxis finden. Derzeit reagiert die Industrie schneller auf demografische Trends und die Bedürfnisse der älteren Generation als die Politik“, kritisierte Klitzing.
Zierke: Föderalismus fördert regionale Lösungen
Stefan Zierke, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), stellte in seinem Grußwort die Vielfalt des deutschen Föderalismus heraus. Selbst, wenn die Strukturen an der einen oder anderen Stelle Reibung erzeugten, sei die Vielfalt der Regionen ein erstrebenswertes Gut, weil sie unter anderem regional funktionierende seniorenpolitische Konzepte und Lösungen ermögliche. „Die Uckermark ist nicht wie Berlin - und sie soll es auch nicht sein“, betonte das Mitglied des Deutschen Bundestages. Zudem führte Zierke aus, dass die gesellschaftliche Rolle der älteren Generation im Rahmen des demografischen Wandels zunehmend wichtiger werde. Daher sei es nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht der Senioren, ihre Bedürfnisse auf allen föderalen Ebenen stark zu artikulieren. „Sie und Ihre Generation haben dafür gesorgt, dass wir in Deutschland gut leben können“, sagte der SPD-Politiker. „Darum müssen Sie dafür auch etwas zurückbekommen.“
Insgesamt wünschte sich Ziercke mehr Offenheit In der öffentlichen Diskussion sowie die Bereitschaft, neue Ansätze nicht von Beginn an zu stigmatisieren. Bei der infrastrukturellen Planung gebe es zum Beispiel oft mehrere Wege, Mobilität auf dem Land zu gewährleisten: „Wenn ich dann die Wahl habe, eine stillgelegte Bahnstrecke zu reaktivieren oder einen Bus an einem Mehrgenerationenhaus halten zu lassen, dann ist der Bus vielleicht die bessere Option.“
Pahl-Weber: Sorgende Gemeinschaften
Professorin Elke Pahl-Weber von der Technischen Universität Berlin hinterfragte in ihrem Impulsvortrag den nach ihrem Ermessen höchst emotional besetzten Gegensatz des Wohnens auf dem Land und in der Stadt: „Wohnen ist heute überall in Deutschland keine Selbstverständlichkeit mehr. Denn als wir den Wohlstand geschaffen haben, haben wir nicht an die Bodenpolitik gedacht“, machte die Diplomingenieurin deutlich, die an der TU Berlin das wissenschaftliche Fachgebiet „Bestandsentwicklung und Erneuerung von Siedlungseinheiten“ leitet.
Größere Auswirkungen für eine „gute Wohnsituation“ älterer Menschen als der Gegensatz „Stadt/Land“ hat nach Auffassung Pahl-Webers, die vor Ihrer Rückkehr in die wissenschaftliche Forschung lange Zeit als freiberuflich als Stadtplanerin tätig war, das Verhältnis, in dem erwerbstätige Jüngere und nicht mehr erwerbstätige Ältere zueinander stehen: „Egal, wo wir wohnen: Wir müssen sorgende Gemeinschaften herstellen. Wir brauchen gewachsene Beziehungen, um in Würde zu altern. Und um diese Gemeinschaften zu schaffen und zu stabilisieren brauchen wir die Unterstützung der öffentlichen Hand. Und zwar seitens des Bundes ebenso wie von Ländern und Kommunen.“
Die häufig geäußerte pauschale Vermutung, dass ältere Menschen in ländlichen Regionen generell abgehängt sind, widerlegte die Professorin: „Im Süden Deutschland, wo traditionell viele Leistungs- und Produktionsbetriebe - teils sogar solche mit globaler Bedeutung, die genannten ´Hidden Champions´ - agieren, funktioniert auch das gesellschaftliche Miteinander“. Problematisch werde das Leben auf dem Land, wenn die Generationenmischungen fehlten und die nötigsten Angebote für ein selbstbestimmtes Leben zusammengebrochen sind. Die Lösung dieser drängenden Probleme, die längst nicht nur die alternden Gesellschaften in Europa, sondern - wie Studien der TU Berlin zeigen - auch Indien oder Ägypten belasten, könne nur durch eine globale Transformation der Wohnraumvorsorgen gelingen. „Hier sind wir gut beraten, wenn wir die speziellen Bedürfnisse und Eigenheiten der Menschen beachten. Denn Wohnraum ist kein Container, den man mit nur mit Menschen füllen muss.“
Eine weitere Voraussetzung, für die Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen in allen Regionen sieht Pahl-Weber in einer flächendeckenden Digitalisierung und einer sich im Dialog aller sozialen Gruppen weiter entwickelte Daseinsvorsorge. „Der Staat, der für die Daseinsvorsorge zuständig ist, darf Aufgaben an die Zivilgesellschaft abgeben und tut es auch: Nur fehlen der Zivilgesellschaft bisher funktionierende Strukturen, sich wirksam einzubringen.“
Scherf: Sozial aktiv bleiben
Der ehemalige Bremer Senatspräsident Henning Scherf berichtete anekdotenreich aus dem aufregenden Leben in seiner Mehrgenerationen-WG: von der Baufinanzierung, der Gartenarbeit, der koordinierten Nutzung des WG-PKWs bis hin zum Aufbau der Unterstützerkreise um die eigentliche Zwölfer-WG herum. Dabei blieben auch schmerzhafte Erlebnisse, wie die gemeinschaftliche Sterbebegleitung für eine Mitbewohnerin nicht unerwähnt. Ganz grundsätzlich geht es Henning Scherf beim Thema seniorengerechtes Wohnen vor allem um Autonomie: „Auch die älteren Menschen wollen ihr Schicksal und ihre Lebensumstände nicht anderen überlassen, sondern selbst bestimmen. Immer öfter fordern sie Teilhabe und Teilnahme ein und das ist auch gut so, denn das hält in Schwung.“
Das wichtigste, so Scherf weiter, sei es auch im Alter immer neue Netzwerke zu knüpfen und aktiv zu bleiben, „denn neben Alterskrankheiten und Altersarmut ist die Alterseinsamkeit das allergrößte Problem.“ Die Antwort könnte aus Sicht des Bremer ‚Aktivisten‘ ganz einfach sein. In Deutschland liege der Anteil der Single-Haushalte bei über 50 Prozent. Gleichzeitig herrsche aber Wohnungsnot. Manche Universitätsstädte hätten daraus schon die richtigen Schlüsse gezogen und organisierten Kooperationen zwischen Seniorenvertretungen und Studentenwerken. Scherf: „Ein früheres Kinderzimmer an Studierende zu vermieten bringt neue soziale Kontakte, entlastet die Haushaltskasse und nimmt Druck vom Wohnungsmarkt, eine eindeutige Win-Win-Situation für alle Beteiligten.“
Scherf appellierte direkt an die Kommunalpolitiker: Der Siedlungsbau der 50er und 60 Jahre passe einfach nicht mehr zu unserer überalterten Gesellschaft. „Wenn Sie heute durch so manche Eigenheimsiedlung spazieren, brennt doch in vielen Häusern nur noch hinter einem Fenster Licht. Dahinter sitzt dann oft ein älterer Mensch und hat Angst überfallen zu werden oder zu vereinsamen. Das könnten alles Mehrgenerationen-WGs werden.“ Gleiches gelte für vernachlässigte innerstädtische Quartiere. „Nehmen Sie die Claudius-Höfe in Bochum. Das war bis 2005 eine verkommene Industriebrache neben dem Hauptbahnhof, früher das Gelände des städtischen Fuhrparks. Dort ist jetzt ein quicklebendiges dorfähnliches Wohnprojekt für Junge und Alte, Behinderte und Nichtbehinderte geworden. Da haben nicht nur die Teilnehmer profitiert, sondern gleich das ganze Stadtquartier.“
Schultze: Verstand statt DIN-Norm
Über senioren- und pflegegerechte Umbaumaßnahmen bestehender Wohnungen informierte Astrid Schultze vom Vorstand der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungsanpassungen e.V. Berlin. Die Praktikerin sieht im Umbau im Bestand die beste Möglichkeit, älteren Menschen mit oder ohne Pflegegrad möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben zu Hause zu ermöglichen. Dabei müsse nicht „immer alles nach der DIN-Norm gehen. Gefragt sind Lösungen, die funktionieren. Und die lassen sich oft sogar schon durch kleine Veränderungen erreichen.“ Das sei wichtig, weil Senioren besonders in Ballungsräumen vor dem Problem stünden, dass ein Umzug in eine seniorengerechte Wohnung oft gar nicht möglich sei, da entweder das Angebot an Wohnraum fehle oder alternative Wohnungen zu teuer seien.
„Deswegen sprechen wir permanent mit den großen Wohnungsbaugenossenschaften und suchen Umbaulösungen, die mit Fördergeldern und den Zuschüssen der Pflegekassen machbar sind“, so Schultze. In stark umkämpften Wohnungsmärkten müssten Eigentümer zudem immer wieder für die Zielgruppe sensibilisiert werden.
Anhand zahlreicher Beispiele aus der Praxis zeigte die Expertin, wie sinnvoll es ist, vor einem Umbau zunächst zu prüfen, wie weit Betroffene mit gängigen Hilfsmitteln kommen: „Eine bessere Lichtsituation, ein Handlauf oder eine intelligent angebrachte Rampe kann so manchen Umbau überflüssig machen oder zumindest aufschieben.“ Werde eine Bestandswohnung umgebaut gehe es darum „zuerst gründlich nachzudenken und dann zu bauen, damit die Maßnahmen am Ende für alle funktionieren.“ Das gelte auch für Barrierefreiheit, die in den wenigsten Fällen zu 100 Prozent gewährleistet werden müsse, wenn individuelle Teillösungen ebenfalls zum Ziel führten.
Bei der Wohnberatung plädierte Schultze für bundesweit einheitliche Strukturen, denn die Beratung funktioniere nicht in allen Bundesländern gleich gut. Es gelte, die Qualität der Wohnberatung zu sichern und auch soziale Kompetenzen zu vermitteln.
Diskussion: Wie gleichwertig ist gleichwertig?
„Leben in der Stadt oder auf dem Land - wie schaffen wir gleichwertige Lebensverhältnisse?“ Der Titel der Podiumsdiskussion ließ Raum für frische Ideen. „Es gibt nicht das eine Rezept für gleichwertige Lebensverhältnisse, das überall passt. Man muss bei allen Vorhaben von Anfang an mit den Menschen vor Ort zusammenarbeiten“, sagte Professorin Elke Pahl-Weber, Dies habe den positiven Nebeneffekt, dass bei notwendigen Veränderungen viel weniger Widerstände aus der Bevölkerung zu erwarten seien.
Das größte Problem bei regionalen Entwicklungsprojekten ist sind nach Pahl-Webers Erfahrung die eingefahrenen planerischen und politischen Strukturen. „Es wird auf allen Ebenen – vom Bund bis zu den Kommunen – immer noch zu sehr in Ressorts gedacht. Da brauchen wir auch neue ‚Belohnungssysteme‘, damit mehr Bereitschaft und Mut für ein neues Denken geweckt wird.“
Grundvoraussetzung für innovative regionale und lokale Lösungen sei, so Pahl-Weber weiter, die flächendeckende Digitalisierung und hier insbesondere der Breitbandausbau. „Gerade in den Bereichen Medizin und Verkehr könnten mit der entsprechenden Infrastruktur viele neue Lösungen das Leben der Menschen grundlegend verbessern.“
Uwe Lübking, Beigeordneter des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, mahnte ebenso wie seine Mit-Diskutantin Pahl-Weber, dass es „die eine Lösung für alle Räume“ nicht gebe: Was in A funktioniere, müsse in B noch lange nicht funktionieren, so Lübking. Auch eine Dezentralisierung von Behörden sei kein Allheilmittel. Es brauche „mehr Mut zu Ungleichheit und Flexibilität“, um ländliche Räume wieder attraktiver und zum Lebensmittelpunkt für mehr Menschen zu machen. So genannte „weiche Faktoren“ wie Gesundheitsversorgung oder Betreuung, Bildung und Mobilität seien das eine, das andere ganz harte Bedingungen wie das Arbeitsplatzangebot vor Ort. Insbesondere auf letzteres hätten Kommunen aber eher weniger Einfluss als etwa Land oder Bund, daher sei eine integrierte, Gebietskörperschaften übergreifende Sozialraumplanung erforderlich, forderte Lübking. Diese sei individuell auf die Gegebenheiten vor Ort auszurichten, möglichst flankiert von einer starken Bürgerbeteiligung, um konkrete Bedürfnisse zu ermitteln und in die Planungen einzubeziehen.
Grundsätzlich, so Lübking, sei das verbindliche Festlegen von Standards der Daseinsvorsorge für den ländlichen Raum zwingend erforderlich. „Dazu gehören Sicherheit und Mobilität ebenso wie die medizinische und pflegerische Versorgung.“ Kritisch sieht Lübking die „Rückständigkeit“ in Sachen Datenversorgung, die den Kommunen die nachhaltige Zukunftsarbeit unnötig erschwere, sowie den Fachkräftemangel, der auch im Planungsbereich für den ländlichen Raum herrsche. Hier müsse nachgesteuert werden, „wenn wir nicht ins Hintertreffen geraten wollen“. Der Kommunalexperte warnte zudem davor, bei der Raumplanung und -entwicklung „weiter auf private Anbieter zu setzen“: Bei einem Weiter so werde man noch in Jahrzehnten auf eine flächendeckende Breitband-Versorgung warten, zeigte sich Lübking mit Blick auf die gewinnorientierten Motive der Privaten skeptisch.
Damm: Interessen ausgleichen
Siegfried Damm, Zweiter Vorsitzender der dbb bundesseniorenvertretung, dankte den Referentinnen und Referenten in seinem Schlusswort für die „gewinnbringenden Informationen und Impulse“ und betonte, dass sich die dbb Senioren auch in Zukunft aktiv in die Gestaltung des Lebensumfelds für die älteren Menschen in Deutschland einmischen werde. „Der Respekt gegenüber den älteren Generationen und die Verantwortung gegenüber den nachfolgenden Jüngeren gebieten es, Teilhabe nachhaltig sicherzustellen – unabhängig vom jeweiligen Wohnort“, so Damm.