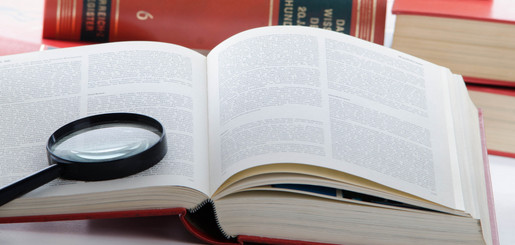Zuhören
Mittel gegen Ignoranz
Es wird geredet und um Aufmerksamkeit gebuhlt. Aber wo ein Sender ist, muss es auch einen Empfänger geben, sonst ist das ganze Gelärme ja umsonst. Das Zuhören wird unterschätzt.
„Du hörst mir gar nicht zu!“ – Ein Klischeesatz, wenn es darum geht, die Stimmung in einer in die Jahre gekommenen Beziehung zu charakterisieren – Langeweile, Verhaltensroutinen, die sich zu Marotten entwickeln. Klar, nach mehreren Jahrzehnten des Zusammenseins können Partner die Sätze des jeweils anderen treffsicher beenden. Sie kennen die Geschichten und welche davon der oder die andere wann warum erzählen würde. Wenn’s gut läuft, vertrauen sich die Partner dann blind, weil beide gut abschätzen können, wie der andere wahrscheinlich reagieren wird, und können „miteinander Pferde stehlen“.
Es läuft aber nicht gut, wenn weniger gut hingehört wird als in jener Zeit, in der die Beziehung noch frisch war. Man erkennt das Gewohnte wieder und schaltet innerlich ab. Nuancen werden überhört und niemand denkt mehr über die Hinter-, Unter- und Abgründe des Erzählten nach. Obwohl in Zweisamkeit lebend, droht den Partnern Einsamkeit.
Und in der Öffentlichkeit auf Straßen und Plätzen, in allen Medien – Radio, Fernsehen, Zeitungen oder in den sozialen Netzwerken des Internets: Ob Wirtschaft, ob Politik, ob Einzelkämpfer oder Mitglieder von Massenorganisationen, alle wollen unsere Aufmerksamkeit. Wer am lautesten schreit, hat recht. Der Lärm der Welt wird unerträglich; wir ziehen uns, reizüberflutet wie wir sind, aus dem Krach zurück. Wir können gar nicht mehr zuhören.
Zentrale Fähigkeit
„Das Zuhören wird unterschätzt“, betont auch Prof. Margarete Imhof in einem Interview mit dem Deutschlandfunk im Dezember 2024. Die Emerita für Psychologie in den Bildungswissenschaften am Psychologischen Institut der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz erstaunt das umso mehr, als Zuhören „doch das Erste (ist), was man kann“. Imhof unterscheidet: einerseits das Hören, der Sinn, der uns Orientierung in der Umwelt bietet und uns Sicherheit gibt. Im Mutterleib lerne das Kind nicht nur, Sprache und Musik zu unterscheiden, sondern auch die mütterliche Stimme von denen aller anderen und Stimmen von anderen Geräuschen zu differenzieren.
Andererseits sei Zuhören aber viel komplexer. Es entwickele sich mit der Sprache, um die empfangenen Informationen verstehen und einordnen zu können. Zuhören ist aus Imhofs Sicht zentral für die Eltern-Kind-Beziehung. Da Sprachinhalte noch nicht (vollständig) verstanden würden, fokussieren sich die Kleinen auch auf Gesten, den Blickkontakt. Sie würden lernen, Sprechweise und Körpersprache des Gegenübers – Mimik und Gestik – zu lesen.
Auch als Erwachsene nehmen wir beim Zuhören neben dem Inhalt auch die „Zwischentöne“, Stimmlage und Tonhöhe, wahr. Im Alter nehmen etwa Demenzpatienten dann wieder verstärkt die nonverbalen Eindrücke wahr, um die Einschränkungen beim verbalen Verständnis auszugleichen. Die populäre Auffassung, dass 80 Prozent der Kommunikation nonverbaler Natur seien, teilt Imhof jedoch nicht.
Hören Frauen besser zu?
Auch die Behauptung, dass es vor allem die Männer seien, die nicht richtig zuhören, hält die Psychologin für ein nur schwer ausrottbares Vorurteil: „Frauen hören nicht besser zu!“ Vielfältig durch Studien belegt ist vor allem, dass Männer und Frauen unterschiedlich hören. So setzt der schleichende Prozess des Verlusts der Hörfähigkeit bei Männern wohl früher ein und verläuft schneller als bei Frauen. Bei Frauen verschlechtert sich das Hören in den Wechseljahren mitunter rapide, weil sich der Hormonhaushalt verändert.
Mitglieder eines Forschungsteams der Uni Tübingen konnten bereits 2011 in einer Studie zeigen, dass „Männer die Schallquelle viel genauer ermitteln [können] als Frauen“, wie eine der beiden Studienleiter, Ida Zündorf, sagte. Das Team war dem sogenannten Cocktailparty-Phänomen nachgegangen: Wer kann sich in einem Raum mit vielfältigen Geräuschen aus unterschiedlichen Richtungen – etwa einer Party – besser auf nur eine Stimme, nämlich die des Gesprächspartners, konzentrieren? Tatsächlich zeigten Männer in dem Test eine bessere Leistung als Frauen. Neben dem Richtungshören nehmen Männer tieferfrequente Geräusche besser wahr, leiden aber stärker und häufiger an Hochtonschwerhörigkeit und nehmen diese Frequenzbereiche verzerrt wahr. Häufig schildern sie sie als unangenehm. Da Frauen- und auch Kinderstimmen in der Regel in einem Frequenzbereich oberhalb dem der Männer liegen, kann so der Eindruck entstehen, Männer hörten nicht zu. Frauen wiederum hören hohe Frequenzen und leise Geräusche besser. Ein Grund könnte sein, dass die Hörschnecke des Innenohres im Schnitt kürzer ist und den Schall schneller verarbeitet.
Laute Welt
Und in der Öffentlichkeit? In seinem jüngst erschienenen Buch „Zuhören: Die Kunst, sich der Welt zu öffnen“ bestätigt der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen die subjektive Wahrnehmung vom stets präsenten Krach: „Wir erleben die große dritte Medienrevolution der Menschheitsgeschichte: erst die Erfindung der Schrift, dann des Buchdrucks und jetzt die Vernetzung der Welt. Die Zuhörverhältnisse ändern sich gewaltig. War es früher schwer zu senden, ist es heute schwer, sich Gehör zu verschaffen“, sagte der Professor, der an der Uni Tübingen lehrt, in einem Ende Januar erschienenen Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit. Er fragt sich: „Wie entsteht Medienmündigkeit auf der Höhe der digitalen Zeit?“
Die Ungeduld in den sozialen Medien, Daueremotionalisierung und Augenblickserregung ergeben gepaart mit dem Versprechen „Du könntest Millionen von Menschen erreichen“, das sich kaum je erfüllen kann, ein grundsätzliches Problem: „Diese Echolosigkeit bei gleichzeitiger Simulation der großen Resonanzmöglichkeit verbittert.“ Pörksen hält „das selbstfürsorgliche Weghören und Nichthören“ in dieser Situation für „unvermeidlich“. Für ihn ist aber die Frage entscheidend, „wie schnell ein Urteil über einen anderen Menschen fällt, ein Urteil, das womöglich das genaue Hinhören blockiert, die Verständigung verhindert“. In Zeiten von Großkrisen komme es entscheidend darauf an, „die gemeinsamen Interessen und Werte in radikal unterschiedlichen Positionen zu entdecken“. Und: „Erst durch das Zuhören werden Kommunikationsbrücken sichtbar, lässt sich das Trennende klären, allerdings auch das Verbindende suchen.“
In diesem Punkt scheint er einig zu sein mit Margarete Imhof. Sie betont, wie wichtig es auch für Profi-Zuhörer wie (Hochschul-)Lehrer, Polizistinnen, Richter oder Therapeutinnen sei, sich zunächst einmal die Zeit zum Zuhören zu nehmen und sich dann konzentriert auf unser Gegenüber einzulassen. ada
Hier wird zugehört
Bremen: Monatliches Zuhör-Café (Nahbei, Findorffstraße 108). Termine unter murmelwelt.de
Düsseldorf: Ehrenamtliche laden zum nachbarschaftlichen Gespräch auf Zuhör-Bänke ein. zuhoeren-draussen.de
Hamburg: Im Zuhör-Kiosk einer Hamburger U-Bahnstation hören Ehrenamtliche montags bis freitags von 12 bis 18 Uhr zu. t1p.de/zuhoer-kiosk
Silbernetz: „Einfach mal reden.“ Kostenfrei unter 0800 4708090 täglich zwischen 8 und 22 Uhr, silbernetz.org